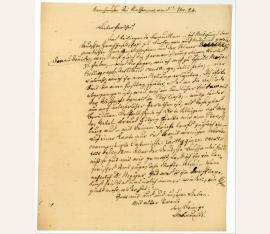Dichter (1777-1843). Eigenh. Brief mit U. ("LMFouqué"). Schloss Nennhausen bei Rathenow. 1 S. 4to.
4.500 €
(92352/BN61601)
An den Verleger Friedrich Christoph Perthes in Gotha in einer verlegerischen Angelegenheit, die das 1826 in Gotha von Joseph Meyer begründete Bibliographische Institut betraf; Perthes legte als Verleger besonderen Wert auf den Schutz des Urheberrechts: "Das [nicht mehr] beiliegende Brouillon - ich Mitglied der deutschen Sprachgesellschaft zu Berlin, wie auch Mitglied zweier nordischen Sprachgesellschaften und der Ulmer Donaudruiden, weiß nicht gleich die Germanisirung obigen Wortes zu finden, - wird Dir sagen, wie ich mich zu [...] Dr.
Meyer Bibliograph. Institutis causa, gestellt habe; - oder vielmehr, wie ich ihm meine Stellung erläutere. Ich schicke Dir's um einen Posttag später, als es an die Behörde abgegangen ist, weil mich ein ländlicher Quidam mit der Abschrift damals im Stich ließ [...] Freund Hitzig [d. i. der Berliner Verleger Julius Eduard Hitzig] sandte mir von Straßburg aus - mit Deinem Briefe traf's zugleich ein - auf einer Karte nur das mit wenigen Worten commentirte Catonische: Carthaginem censeo esse delendam. Aber der deutsche Buchhandel hat's nicht so gut mit mir gemacht, daß ich ihm ein Censorisches Amt zugestehn dürfte. Also! - Wenn nehmlich Dr. Meyer thut was ich ihm vorschlage. Sonst heißt es natürlich immer wieder: 'ein Schelm giebt mehr, als er hat!' […]". - Im Vorjahr hatte Meyer begonnen, die auf 150 Bände angelegte "Bibliothek der deutschen Classiker" herauszugeben. Aus der Autographensammlung Annette von Droste-Hülshoff..